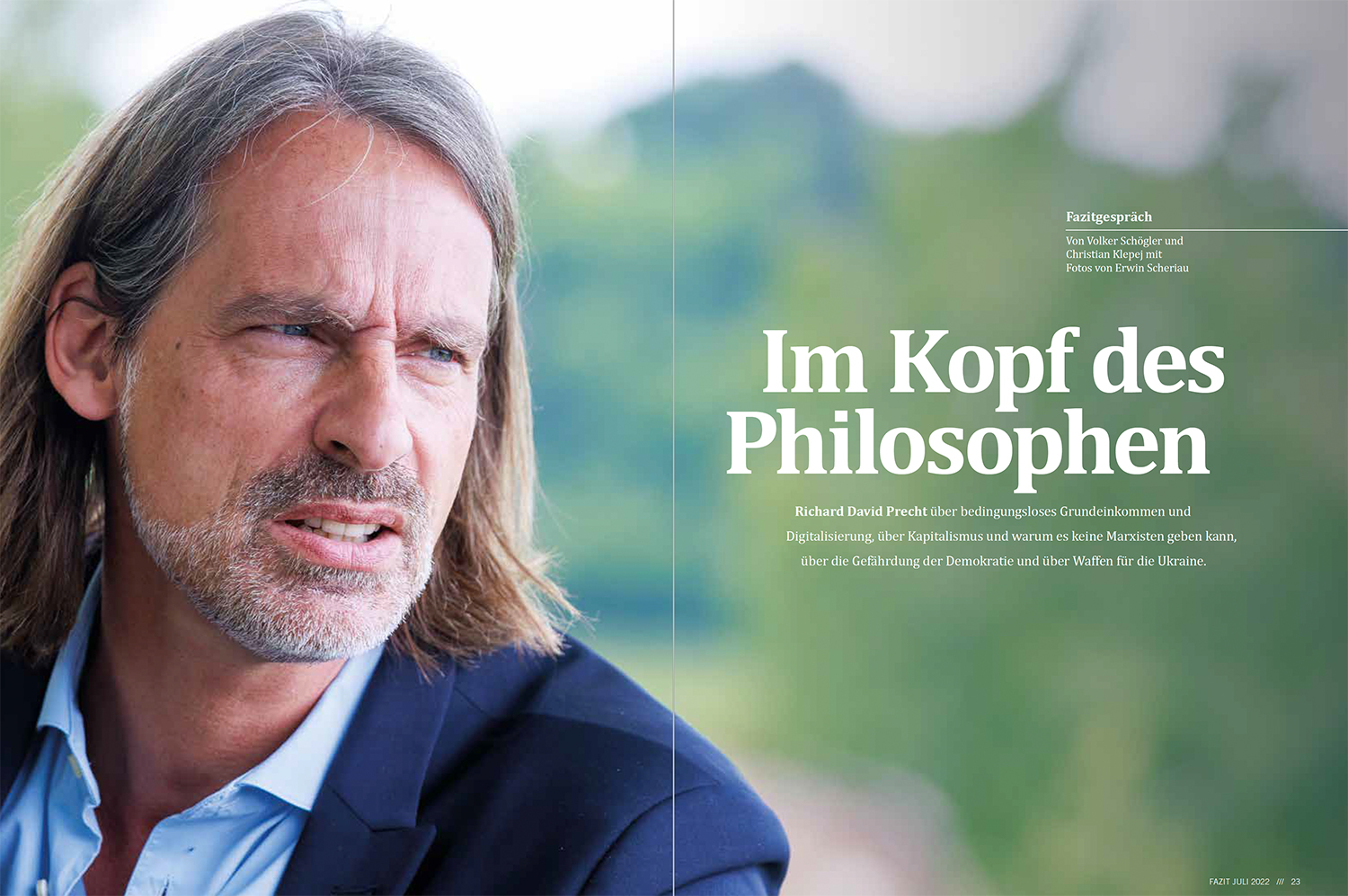Im Kopf des Philosophen
Christian Klepej | 15. Juli 2022 | Keine Kommentare
Kategorie: Fazit 184, Fazitgespräch
Richard David Precht über bedingungsloses Grundeinkommen und Digitalisierung, über Kapitalismus und warum es keine Marxisten geben kann, über die Gefährdung der Demokratie und über Waffen für die Ukraine.
Das Gespräch führten Volker Schögler und Christian Klepej.
Fotos von Erwin Scheriau.
::: Hier im Printlayout online lesen
Richard David Precht kam schon mit Verspätung am Flughafen Thalerhof an und erreichte Schloss Seggau gerade noch eine halbe Stunde vor seinem Vortrag. Unser Interviewtermin war damit geplatzt. Gänzlich unprätentiös stellte er sich nach einem schnellen Kaffee dennoch unserem Fotografen für eine Bilderserie, um sich anschließend für ein paar Minuten zurückzuziehen.
»Zum Meditieren«, wie er uns sagte. Precht – so heißt auch seine Sendereihe im ZDF –, der in Deutschland als »Popstar der Philosophie« gilt, war Anfang Juni einer von mehreren hochkarätigen Rednern und Diskutanten zum Thema »Green Deal« (Grüne Transformation) beim 10. Pfingstdialog »Geist & Gegenwart« im südsteirischen Schloss Seggau. Der Autor, Moderator und Philosoph referierte über »Nachhaltigkeitsrevolution« und »Digitale Revolution«, um am Ende die einfache philosophische Frage der »Sinngesellschaft« zu stellen: »Gelingt uns das Leben, ist es glücklich?«.
Dafür wird er vor allem in deutschen Medien gern als zu populärwissenschaftlich gescholten. Dass er eben nicht im Elfenbeinturm sitzen will, zeigte er unmittelbar nach dem Vortrag und langer Podiumsdiskussion, als er mit uns noch das folgende, mehr als zweistündige Fazitgespräch führte.
***
Die steirische Landeshauptstadt Graz hat sein einigen Monaten eine kommunistische Bürgermeisterin. Könnte das jener Sozialismus im Kapitalismus sein, wie Sie es einmal als gut und wichtig formuliert haben?
Das habe ich in Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gesagt, wobei es aber auch gute liberale Argumente für ein Grundeinkommen gibt. Das ist nicht nur eine Idee, die die Sozialisten gepachtet haben, sehr viele Sozialisten sind ja auch gegen das Grundeinkommen, aber es gibt diesbezüglich eine sozialistische Tradition. Sozialismus in den Kapitalismus zu implementieren, ist ja eine uralte Erfolgsgeschichte. Das gilt etwa für die soziale Marktwirtschaft, die im Grunde genommen die Forderungen der SPD aus dem Kaiserreich erfüllt und den Kapitalismus sozial abgesichert hat. Und das Grundeinkommen wäre die Anpassung für das 21. Jahrhundert, also eine zeitgemäße soziale Absicherung. Alle erfolgreichen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, die wir im Regelfall mögen und bewundern, sind aus der kapitalistischen und sozialistischen Idee zusammengesetzt und es kommt auf das richtig implementierte Mischungsverhältnis an. Beides in Reinform funktioniert nicht dauerhaft. Bei uns werden die Segnungen des Kapitalismus vielleicht nicht perfekt, aber gut verteilt.
Das heißt, Richard David Precht ist gar kein so vehementer Kapitalismuskritiker, als der er gemeinhin wahrgenommen wird?
Ich würde den Begriff Kapitalismuskritiker für mich selber nicht verwenden. Ich glaube, wenn wir mit Begriffen wie Sozialismus und Kapitalismus schablonisieren, schaffen wir im Zweifelsfall eher Verwirrendes, als wenn wir die Dinge ohne diese Begriffe benennen.
Aber Sie verwenden in ihren Büchern gern die noch älteren Begriffe »links« und »rechts«, die ja eigentlich auch schon überkommen sind.
Die auf bestimmte Art und Weise ebenfalls überkommen sind, ja. Ich meine, man muss überlegen, wir operieren hier mit Begriffen aus dem 19. Jahrhundert. Heute, im 21. Jahrhundert, muss man sagen, den Kapitalismus gibt es nicht. Der Kapitalismus, der die Kinder in den Bergwerken verheizt hat, ist nicht der gleiche Kapitalismus wie die soziale Marktwirtschaft in Österreich heute. Da gibt es zwar Strukturgemeinsamkeiten, aber die Unterschiede sind größer als die Gemeinsamkeiten. Das macht die ganze Sache eben schwierig. Das Gleiche gilt auch für die Frage, was soll eigentlich der Sozialismus sein? Also wie groß sind die Unterschiede zwischen dem, was die Frühsozialisten sich erträumt haben und dem, was Lenin in Russland realisiert hat – da gibt es fast keinen Berührungspunkt. Das macht diese Begriffe so schwierig, das sind »Konnotationscluster«.
Und wie sieht das mit dem Marxismus aus, zu dem sich etwa unsere Bürgermeisterin bekennt? In der Sendung »Stöckl« haben Sie kürzlich gesagt, dass Sie in einem linken Elternhaus sozialisiert wurden.
Ja, das ist so, mein Vater gehört zu den Menschen, die Marx tatsächlich gelesen haben – und vieles andere auch. Mit seiner Analyse über die Schwächen des Kapitalismus bin ich aufgewachsen. Ich bin kein Marxist und ich würde mich auch schon deswegen nie so bezeichnen, weil auch Karl Marx es nicht getan hat. Es gibt ja eine berühmte Formulierung, die er gegenüber seinem Schwiegersohn Paul Lafargue benutzt und gesagt hat, er wäre kein Marxist. Marx hatte nicht das Gefühl, eine Weltanschauung oder eine Ideologie begründet zu haben, sondern die Funktionsmechanismen des Kapitalismus durchschaut zu haben. Und von da aus ein quasi naturgesetzliches Modell der Menschheitsentwicklung formuliert zu haben. Das hat er als seine Leistung betrachtet. Wobei der prophetische Charakter der deutlich schwächere ist, aber der analytische ist eine sehr gute Analyse des Kapitalismus des 19. Jahrhunderts gewesen. Deswegen bedeutet Marxist zu sein eigentlich immer, aus Marx etwas zu machen, was ihm nicht entspricht. Man macht aus Marx keine Weltanschauung, dagegen hätte sich Marx massiv verwehrt.
Sie ziehen auch Parallelen mit einer religiösen Komponente?
Das Christentum hat aus Jesus ja auch eine Menge Dinge gemacht, die fast keinen Berührungspunkt mehr mit Jesus haben. Die beiden großen Ideologen des Christentums, Paulus und Augustinus, haben diese Religion erfunden und etwas völlig anderes daraus gemacht als das, was ursprünglich Jesus war. Jesus wollte keine Religion begründen, Marx wollte keine Weltanschauung in die Welt setzen. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich habe mich mit Religion sehr beschäftigt und mich im Zuge des ersten Bandes meiner Philosophiegeschichte und auch jetzt in meinem neuen Buch über die Arbeit intensiv mit dem Christentum beschäftigt.
Eines ihrer Hauptthemen in Ihren Büchern ist die Gefährdung der Demokratie – durch die geänderte Auffassung »Von der Pflicht«, wie auch ein Buchtitel lautet, oder durch Auswüchse der Digitalisierung oder »Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten«. Wie gefährdet ist unsere Demokratie tatsächlich?
Ja, sie ist, wie man feststellen muss, erstaunlich labil. Das würde man nicht vermuten, unsere westlichen Demokratien sind eine enorme Erfolgsgeschichte. Aber man muss sich fragen, was hält eine Gesellschaft im Innersten zusammen? Das waren früher Religionen, Institutionen oder Autoritäten. Jetzt haben wir, und das ist eine gute Entwicklung, den Respekt vor Autoritäten weitgehend verloren und eingebüßt, den Respekt vor Institutionen und vor der Religion ganz besonders. Die Frage lautet, was tritt an deren Stelle? Weil ohne sozialen Kitt können unsere freiheitlich-liberalen Demokratien nicht existieren. Es gibt dieses berühmte Zitat von dem Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde, wonach die moderne liberale Demokratie an Voraussetzungen gebunden ist, die sie nicht selbst erzeugen kann. Sie braucht quasi Bürger mit viel Bürgersinn, kann aber niemand zum Bürgersinn zwingen. Als gläubiger Mensch meinte er das tatsächlich konfessionell; er bedauerte den Verlust der Religion.
Gefährdet sind also zuerst Zusammenhalt und Solidarität und damit dann die Gemeinschaft selbst.
Es wird schwierig, wenn der Kapitalismus jeden Einzelnen über kurz oder lang zum Kapitalisten seiner selbst macht, der quasi das Maximale für sich erwirtschaften möchte. Dann stellt sich die berechtigte Frage, woher sollen Gemeinschaft und Gemeinsinn kommen? Und das ist in der Tat ein fragiler Punkt unserer Demokratie. Deshalb habe ich damals im Buch über die Pflicht unter anderem den Vorschlag – der kein Allheilmittel ist! – gemacht, dass Jugendliche und Pensionisten zwei Pflichtjahre machen sollten, damit der Pflichtgedanke nicht aus der Gesellschaft verschwindet. Es gibt eine große deutsche Zeitung, die, als ich diesen Vorschlag vor zehn Jahren in einer Talk-Show zum ersten Mal formuliert habe, über viele Jahre im Internet darüber hat abstimmen lassen. Der Vorschlag wurde gar nicht ausführlich erklärt, trotzdem war das Ergebnis fifty-fifty. Der Resonanzboden in der Gesellschaft ist also ziemlich groß.
Damit kommen wir wieder zu dem von Ihnen sehr konsequent eingeforderten bedingungslosen Grundeinkommen. Mit wem immer man spricht, es scheint jeder etwas anders darunter zu verstehen? Sie selbst sollen anfangs auch dagegen gewesen sein?
Das ist richtig und absolut wahr. Weil die Leute, die dafür waren, mich nicht überzeugt haben – manchmal ist es ja so platt. Und ich dachte, mein Gott, unser Sozialsystem mit einem solchen grundsätzlich anderen System zu konfrontieren, das gehört in den Bereich der nicht realisierbaren Utopien. Das war vor zehn Jahren, aber meine Beschäftigung mit der Digitalisierung hat meine Meinung über das Grundeinkommen komplett verändert.
Weil sich die Arbeitswelt so grundlegend verändern wird?
Wenn sie sich derart verändert – man muss auch sagen, emanzipatorisch verändert und auch insgesamt zum Guten – dann sind alle Grundlagen, auf denen unsere Sozialstaaten bisher beruhen, unterspült. Und dann war mir klar, dass der Bruch gar nicht so groß ist, weil das bestehende Sozialsystem dauerhaft ja ohnehin nicht erhalten bleiben wird. Und dann ist es nur noch eine logistische Frage des schrittweisen Übergangs in eine Grundeinkommensgesellschaft. Von der ich glaube, dass sie in etwa zwanzig Jahren realistisch werden kann, aber nur unter der Voraussetzung, dass wir bereits jetzt bestimmte Weichen stellen, wie zum Beispiel eine deutliche Veränderung der Besteuerung.
Eine Frage zur Lohnarbeit, die bei Ihnen nicht immer gut wegkommt: Ist sie nicht auch ein wesentlicher Teil eines sinnerfüllten Lebens?
Ich bin doch nicht derjenige, der die Lohnarbeit abschaffen will, ich glaube, dass aber in einigen Bereichen die digitale Revolution die Lohnarbeit abschafft und man dann überlegen muss, wie gehen wir damit um. Ich habe nicht das radikalmarxistische Ziel, jeden Menschen aus der Lohnarbeit rauszuholen. Es gibt ja befriedigende und unbefriedigende Lohnarbeit.
Das kann man bei Ihnen aber auch anders lesen, wenn sie Paul Lafargue oder Oscar Wilde anführen, die sehr explizit dem Gedanken anhängen, dass Lohnarbeit überhaupt das Schlimmste sei.
Ja, aber diese Leute hatten natürlich um 1880, als »Das Recht auf Faulheit« geschrieben wurde oder um 1900, als Oscar Wilde den »Sozialismus und die Seele des Menschen« geschrieben hat, die knochenharte Fabrikarbeit jener Zeit vor Augen, für die man den Begriff »sinnstiftend« nicht einmal entfernt verwenden konnte. Heute haben wir, wie Sie ja zu Recht sagen, viele Arbeitsverhältnisse, die als sinnstiftend empfunden werden und zwar aus zwei wirklich selten differenzierten Motiven heraus. Der seltenere Fall ist die sinnstiftende Arbeit, der häufigere das sinnstiftende Eingebundensein in ein soziales Umfeld – weil man etwa einen sozialen Raum mit Kollegen hat. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Langfristig sehe ich, dass die Arbeit der Maschinen zumindest im gesamten gigantischen Bereich der geistigen Routinearbeit – von den einfachen Tätigkeiten in der Fertigung, über Verwaltung und Banken, bis zur juristischen Recherchearbeit in den Anwaltskanzleien – diese Leute da rausreissen werden. Wir brauchen einen grundsätzlichen Strukturwandel in der Gesellschaft, damit Menschen nicht von etwas, was sie weitestgehend als sinnvoll erleben, in eine Sinnlosigkeit entlassen werden. Natürlich bleibt genug menschliche Arbeit übrig, aber die Frage wird sein, ob das auch angemessen bezahlte Arbeit sein wird. Und das bezweifle ich.
Wenn das Grundeinkommen in bestimmten Fällen dann doch nicht ausreicht, gibt es aber kein Netz mehr, oder?
Das stimmt natürlich. Die Idee des Grundeinkommens ist es, andere Sozialabsicherungen überflüssig zu machen. Aber erstens wäre man nicht mehr in gleichem Maße stigmatisiert wie heute im Zustand ohne Arbeit und zweitens ist die ausbezahlte Summe höher als bei der Sozialhilfe beziehungsweise Hartz IV in Deutschland.
Die Hoffnung ist, dass es einen zivilisatorischer Fortschritt darstellt, die Bedingung ist aber, dass Weichen und Stellschrauben schon heute gestellt und justiert werden. Welche sind die wichtigsten?
Wir dürfen nicht zuerst den Sozialstaat abbauen, das müssen wir als letztes, wir müssen zuerst die Finanzierung sichern und parallel dazu das Bildungssystem verändern, denn das heutige ist mit dem bedingungslosem Grundeinkommen völlig inkompatibel. Unser System ist die Vorbereitung darauf, in der klassischen Erwerbsgesellschaft zu funktionieren und nicht ein selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Leben zu führen. Und so eine Bildungstransformation braucht zehn bis zwanzig Jahre.
Zum Klimawandel: Sie sind diesbezüglich kein Freund technischer Lösungen?
Zu sagen, wir lösen das allein über Technik, heißt, den Leuten den falschen Wein einzuschenken, weil es gleichzeitig suggeriert: Du musst dein Leben nicht ändern. Ohne klare staatliche Direktiven werden wir den Klimawandel nicht bewältigen. Ich habe als Zeitzeuge, wie Sie auch, erleben können, wie wir beim Beispiel des Elektroautos alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Und meine Befürchtung ist, dass das so weitergeht. Wir haben gesagt, wir haben eine technische Lösung und gleichzeitig, wir muten den Leuten keinen Verzicht in irgendeiner Form zu. Was haben wir gemacht? Wir haben den hochproblematischen, fetischisierten Individualverkehr mit seiner statusdiversifizierten Produktpalette ersetzt durch eine Elektromobilität als fetischisierten Individualverkehr mit statusdiversifizierter Produktpalette. Wir haben also genau das Problem einfach nur kopiert. Wir haben auf der einen Seite das Problem Verbrennen von Öl durch das Problem Ausbeuten von Bodenschätzen in hochproblematischen Regionen mit entsetzlichen Menschenrechtskosten substituiert. Die wichtigste Botschaft aber wäre gewesen: Wir reduzieren den Verkehr.
Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine: Wie beurteilen Sie die Waffenlieferungen an die Ukraine?
Ich halte Waffenlieferungen für das strategisch falsche Mittel, weil ich auch ohne Pazifist zu sein glaube, dass es entgegen der offiziellen Rhetorik die Situation der Menschen in der Ukraine dauerhaft nicht verbessert, sondern verschlechtert. Die realistische Frage ist heute nicht mehr: Wie bringe ich die Ukraine in eine Position militärischer Stärke, denn das wird offensichtlich nicht möglich sein. Die Front in der Ukraine ist 2400 Kilometer lang. Wie viele schwere Waffen wollen sie da denn liefern und wie sollen die irgendwo ankommen? Wir müssen alles tun, um darauf einzuwirken, dass dieser für die Ukraine militärisch anscheinend nicht gewinnbare Krieg nicht noch grausamer wird und noch mehr Menschenleben kostet. Und das geht nur über Verhandlungen.
Herr Precht, vielen Dank für das Gespräch.
*
Richard David Precht, geboren am 8. Dezember 1964 in Solingen, ist Autor, Vortragender, Philosoph, Moderator, Herausgeber und Honorarprofessor. Er promovierte als Germanist über Robert Musil (»Der Mann ohne Eigenschaften«), erzielte vor 15 Jahren mit »Wer bin ich – und wenn ja wie viele?« seinen ersten Beststeller und hat seitdem mehr als ein Dutzend weiterer Bücher geschrieben. Auch mit der TV-Reihe »Precht«, mit dem Podcast »Lanz & Precht« oder als Gast in Talkshows praktiziert er öffentliches Philosophieren. Precht ist geschieden, hat ein Kind und lebt in Düsseldorf und Spanien. richarddavidprecht.de
Fazitgespräch, Fazit 184 (Juli 2022), Fotos: Erwin Scheriau
Kommentare
Antworten