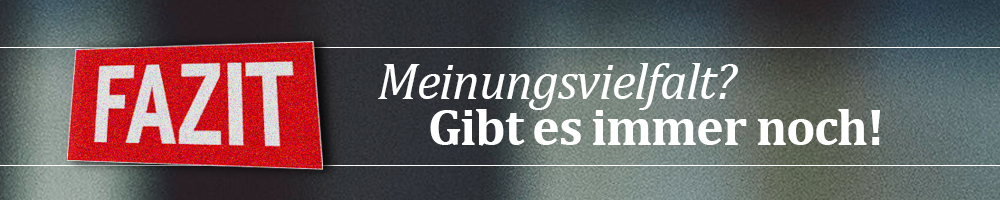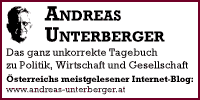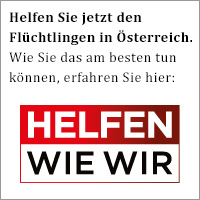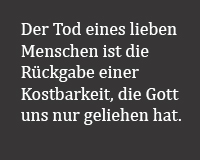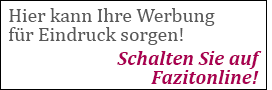Tandl macht Schluss (Fazit 217)
Johannes Tandl | 14. November 2025 | Keine Kommentare
Kategorie: Fazit 217, Schlusspunkt
Linker Antisemitismus. Die moralische Tarnkappe des Hasses. Antisemitismus war lange das Monopol der Rechten. Er war dumpf, völkisch und aggressiv. Heute trägt er andere Kleider – akademische, aktivistische und moralische. Er spricht von Gerechtigkeit und Unterdrückung, von Kolonialismus und Kapital. Und doch bleibt sein Kern derselbe: die uralte Obsession, das Böse in der Welt mit dem Jüdischen zu identifizieren – heute halt als »Kritik an Israel« codiert.
::: Hier können Sie den Text online im Printlayout lesen: LINK
Der linke Antisemitismus ist kein Zufall. Karl Marx schrieb 1844, das praktische Wesen des Juden sei der Schacher – ein Satz, der Kapitalismuskritik und Judenfeindlichkeit dauerhaft miteinander verband. In der Folge wurde der Jude zum Symbol des entfremdeten Marktes, des globalen Kapitals, des kalten Geldes. Noch heute finden sich in manchem »antikapitalistischen« Diskurs dieselben Bilder – nur modernisiert: »Finanzeliten«, »globale Player«, »Zinsgewinner«. Man spricht nicht von Juden, aber man meint sie. Seit den Neunzehnsechzigerjahren verlagert sich die Bühne. Der »reiche Händler« wird als Projektionsfläche vom Staat Israel ersetzt. In der Sprache der postkolonialen Linken gilt der jüdische Staat als Außenposten des Westens, als Unterdrücker der Entrechteten. Antizionismus wird zum moralischen Code, in dem sich der jahrhundertealte Hass neu formiert. Natürlich darf man Israels Politik kritisieren – wie jede andere. Doch wer Israel dämonisiert, ihm allein das Existenzrecht abspricht oder seine Bürger weltweit haftbar macht, überschreitet eine Grenze, die nichts mehr mit Politik zu tun hat.
Linker Antisemitismus ist besonders tückisch, weil er sich als Mitgefühl tarnt. Wer Israel verurteilt, sieht sich auf der Seite der Opfer. Doch in Wahrheit kehrt sich die Moral um. Die Nachfahren derer, die den Juden einst ihre Menschlichkeit absprachen, erklären sie heute zu Tätern. Aus historischer Verantwortung wird moralische Entlastung. Der Hass kommt nicht mehr im Zorn, sondern im Namen der Gerechtigkeit.
Und weil diese Haltung intellektuell daherkommt, gilt sie vielen als diskursfähig. Universitäten, NGOs und Kulturhäuser übernehmen den Code des »Dekolonialismus« – und merken nicht, wie schnell er kippt. Wo Machtverhältnisse zum alleinigen Maßstab werden, müssen die Juden zwangsläufig wieder auf der falschen Seite stehen: zu mächtig, zu westlich, zu weiß, zu privilegiert. Dass jüdische Studierende sich heute an europäischen Unis wieder fürchten müssen, ist das Symptom einer moralischen Verwilderung, die sich selbst für Aufklärung hält. Noch gefährlicher ist, dass sich diese Haltung längst in Medien, Feuilletons und politischen Stiftungen eingenistet hat – also in jenen Räumen, die sich selbst als Korrektiv der Gesellschaft verstehen.
Der Unterschied zu rechtem oder islamistischem Judenhass liegt allein im Tonfall. Dort kommt er mit Fahne, hier mit Hashtag. Dort im Namen der »Patrioten«, hier im Namen der Gerechtigkeit. Aber in der Logik ist er identisch. Er sucht Sündenböcke, konstruiert Schuld, erklärt das Jüdische zum Störfaktor einer heilen Welt. Und er folgt derselben psychologischen Versuchung: Wer sich moralisch überlegen fühlt, braucht keinen Zweifel – Juden als Feindbilder reichen da völlig.
Linker Antisemitismus ist darum nicht harmloser, sondern heute sogar gefährlicher. Schließlich befindet er sich nicht am extremistischen Rand, sondern in der Mitte der Gesellschaft und des moralischen Diskurses. Weil er sich in wohlmeinenden Worten versteckt und im Brustton der Empörung argumentiert. Der rechte Antisemitismus schreit, der linke flüstert – und wird gerade deshalb oft überhört. Wer den Hass wirklich bekämpfen will, muss auch diesen Ton erkennen. Antisemitismus ist keine politische Meinung, sondern eine Denkform. Und diese Denkform kennt keine Himmelsrichtung. Sie findet nur immer neue Sprachen, um sich selbst zu verbergen.
Denn am Ende ist es gleichgültig, ob jemand die Juden im Namen des Volkes, des Propheten oder der Gerechtigkeit verachtet. Das Ergebnis bleibt immer dasselbe: Ausgrenzung, Entmenschlichung und Gewalt. Antisemitismus hat viele Gesichter, aber immer dasselbe Ziel – die Auslöschung dessen, was an die eigene Schuld erinnert.
Tandl macht Schluss! Fazit 217 (November 2025)
Kommentare
Antworten