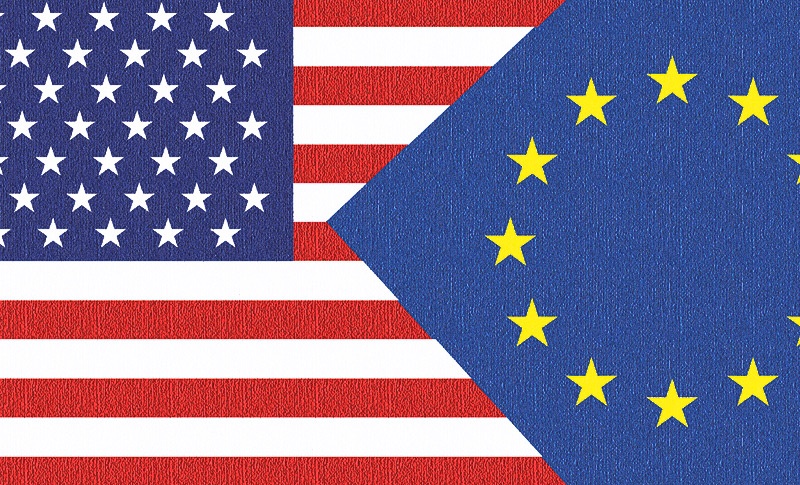Friedensbringer Freihandel
Redaktion | 19. November 2015 | Keine Kommentare
Kategorie: Fazit 118, Fazitthema
Wer miteinander handelt, schießt nicht aufeinander. Wenn es um die »Willkommenskultur« geht, ist die Aufklärung in aller Munde. Zum Friedenskonzept der Aufklärer gehört jedoch auch die Möglichkeit der Völker, frei miteinander Handel zu treiben.
::: Hier können Sie den Text online im Printlayout lesen: LINK
Wenige politische Debatten sind ideologisch so aufgeladen wie die um das Wesen der freien Märkte und aktuell um das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Während die Liberalen dem Freihandel fast religiöse Heilswirkungen zusprechen und jeden Widerspruch als sozialistische Romantik abtun, formieren sich auf beiden Seiten des Atlantiks globalisierungskritische NGOs, die in den Märkten ein zerstörerisches System sehen, vor dem sie die Bürger unbedingt schützen wollen. Als Beleg für die destruktiven Kräfte des Kapitalismus ziehen sie die globale Wirtschaftskrise und die daraus resultierenden sozialen und ökonomischen Verwerfungen heran. Sie sind davon überzeugt, dass staatliche Organe durch Liberalisierung und Globalisierung nicht in ihren Möglichkeiten zur Regulation eingeschränkt werden dürfen.
Der Freihandel ist ein Kind der Aufklärung
Die Aufklärer zeigten sich davon überzeugt, dass Freihandel Frieden bringt, weil er den Wohlstand maximiert. Wer auf Augenhöhe miteinander Geschäfte macht, hat kein Interesse daran, seine Ziele mit Waffengewalt durchzusetzen. In ihrer Kritik am staatlich gelenkten und protektionistisch ausgerichteten Merkantilismus erkannte etwa der Begründer der klassischen Nationalökonomie, Adam Smith, dass nichts besser für einen gewaltfreien Interessensausgleich der Staaten sorgt als die regulierende Kraft des Marktes, weil er mit unsichtbarer Hand für die Maximierung des Wohlstandes sorgt. Nach Smith strebt zwar kein einzelner Marktteilnehmer direkt danach, das Volkseinkommen zu maximieren, sondern handelt egoistisch. Dennoch führt der Gleichgewichtsmechanismus des Marktes – wie durch eine unsichtbare Hand gelenkt – zum volkswirtschaftlichen Optimum. Das eigennützige Streben der wirtschaftenden Menschen und Unternehmen trägt somit zum Wohl der gesamten Gesellschaft bei. Allerdings definiert Smith eine wichtige Einschränkung: Die Entstehung von Monopolen, also die einseitige Möglichkeit, den Markt zu beherrschen, müsse rigoros unterbunden werden.
Der Freihandelsansatz von Smith besagt im Großen und Ganzen, dass es einer Volkswirtschaft dann am besten geht, wenn sie jene Güter produziert und exportiert, bei denen sie Kostenvorteile hat, und jene Güter importiert, bei denen sie preislich nicht mithalten kann. Bis heute teilen liberale Ökonomen wie Friedman oder Hayek die Grundannahmen von Smith, dass der Freihandel eine friedensfördernde Wirkung hat.
Und auch Immanuel Kant – als Zeitgenosse von Adam Smith – argumentierte ähnlich: »Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann und der früher oder später sich jedes Volkes bemächtigt.« Für Kant, dessen Schrift »Zum ewigen Frieden« ja als Vorlage für die UN-Charta gilt, mussten jedoch noch weitere Bedingungen erfüllt sein, um Frieden stiften zu können. Dazu gehört etwa die politische Partizipation der Bevölkerung im Rahmen einer republikanischen Verfassung. Außerdem sollte der »anarchische Naturzustand der internationalen Politik durch eine föderative Vereinigung der Staaten« überwunden werden. Kant erkannte ein Staatsbürgerrecht, das die Beziehungen der Bürger zum eigenen Staat regelt, ein »Völkerrecht« für die Beziehungen der Staaten untereinander und ein sogenanntes »Weltbürgerrecht«, das einen Ausgangspunkt bei der Formulierung der universellen Menschenrechte bildete. Auf dieses Weltbürgerrecht lohnt es sich auch wegen der aktuellen Flüchtlingsthematik näher einzugehen: Nach Kant sollte das »Weltbürgerrecht« auf die Bedingungen der »allgemeinen Hospitalität« eingeschränkt sein. Kant billigt somit zwar jedem Menschen eine völlige, internationale Bewegungsfreiheit in Form eines Besuchsrechtes zu, »… solange er sich selbst rechtmäßig verhalte«. Der Fremde habe allerdings keinen Anspruch auf ein Gastrecht oder gar andauernde Alimentierung.
Kritik an der friedensstiftenden Kraft des Freihandels
Allerdings haben sich auch zahlreiche andere Schulen und Gedankengebäude entwickelt, die den Freihandel als friedensstiftende Kraft verneinen. So sind etwa die Protektionisten überzeugt, dass Freihandel zu Konflikten führt und deswegen die eigene Wirtschaft den Schutz des Staates vor ausländischer Konkurrenz braucht. Die Protektionisten lehnten den Freihandel nicht völlig ab. Staaten sollten jedoch »einen ähnlichen Stand an Zivilisation, Reichtum und Macht« erreicht haben, bevor sie Freihandel betreiben. Diese Voraussetzungen für einen binnenmarktähnlichen Handel zwischen der EU und den USA betrachten übrigens auch nicht liberale TTIP-Befürworter als erfüllt.
Die heftigste Kritik am Freihandel liefert hingegen der Marxismus. Er versteht sich auch heute noch als klassische Gegentheorie zur liberalen Lehre und besagt, dass Freihandel abzulehnen ist, weil er die Freiheit des Kapitalverkehrs zur Grundlage hat. Ohne nationale Barrieren für das Kapital trete der Gegensatz zwischen den Klassen noch stärker hervor (»gewissenlose Handelsfreiheit«). Der Freihandel verschärfe, so moderne Marxisten, die nationale und internationale Ungleichheit, was niemals friedensfördernd sein könne.
Freihandel als Basis für das europäische Friedensprojekt
Gezielt für die Durchsetzung von Friedensinteressen wurde das Konzept des Freihandels übrigens von europäischen Gründervätern, Alcide de Gasperi, Robert Schumann und Konrad Adenauer, genutzt. Ausgangspunkt war die Idee des französischen Außenministers Robert Schuhmann, die kriegswichtige Stahl- und Kohleproduktion der wichtigsten europäischen Länder miteinander zu vernetzen und zu vergemeinschaften. Zukünftig sollten Kriege, etwa zwischen Deutschland und Frankreich, unmöglich werden, weil keines der Länder ohne das andere über eine die erforderlichen Produktionsmittel für kriegswichtige Güter verfügen würde. So entstand die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) oder Montanunion. Ein knappes Jahr später, am 18. April 1951, wurde in Paris die Gründung dieser Union beschlossen. Mitglieder waren zunächst Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande.
Diese Montanunion bildete den Kristallisationspunkt für die heutige Europäische Union. Inzwischen gibt es einen EU-Binnenmarkt mit vier Grundfreiheiten als höchste Stufe des Freihandels zwischen souveränen Staaten. Die Dienstleistungsverkehrsfreiheit ermöglicht Unionsbürgern die freie, grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Binnenmarkt ohne Beeinträchtigung aufgrund von Staatsangehörigkeit. Die Kapitalverkehrsfreiheit hat den Transfer von Geldern und Wertpapieren in beliebiger Höhe zwischen den Mitgliedstaaten liberalisiert. Die Personenverkehrsfreiheit eröffnet den Unionsbürgern das Recht, in jedem anderen Mitgliedstaat zu wohnen und zu arbeiten, und die Warenverkehrsfreiheit ermöglicht es, dass Waren im gesamten Binnenmarkt frei zirkulieren können.
Obwohl zahlreiche Konflikte zwischen den Mitgliedsländern der Union bestehen, ist die Kriegsgefahr innerhalb der EU so gut wie nicht existent. Und auch unter den 34 zur OECD zusammengefassten Industriestaaten gibt es keine Kriege mehr. Die OECD-Staaten erweisen sich als wirtschaftlich und gesellschaftlich homogen genug, dass jeder von ihnen von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit stärker profitiert, als er es durch einen Krieg gegen ein anderes OECD-Land jemals könnte. Trotz ökonomischer und politischer Spannungen zwischen manchen Mitgliedsländern ist der EU-Frieden auch der OECD-Frieden nicht gefährdet.
Die Umsetzung der Freihandelstheorie von 1860 bis heute
Im Jahr 1860 setzten England und Frankreich mit dem »Cobden-Vertrag« erste Schritte zur Liberalisierung ihrer Handelsbeziehungen, indem sie das Meistbegünstigungsprinzip durchsetzten. Es sollte unmöglich werden, Handelsvergünstigungen nur einzelnen Staaten zu gewähren und andere zu benachteiligen. Die Meistbegünstigungsklausel ist bis heute Bestandteil sämtlicher Abkommen und gehört auch zum Bestand des WTO-Rechtes.
Da der englische und der französische Markt Mitte des 19. Jahrhunderts eine ähnliche Bedeutung hatten wie heute jener der USA und der EU, versuchten die meisten anderen Länder – mit Ausnahme von Russland und den damals wirtschaftlich noch nicht so wichtigen USA – in diesem Abkommen unterzukommen. Mit dem Börsencrash von 1873 und der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise setzten sich in mehreren Staaten, wie etwa dem Deutschen Reich, protektionistische Haltungen durch. Und mit dem Ersten Weltkrieg galt diese erste Freihandelsperiode ohnehin als beendet.
Nach dem Ersten Weltkrieg setzten die mittlerweile zur wirtschaftlichen Supermacht aufgestiegenen USA ihre Isolationspolitik fort. Die Monroe-Doktrin der Nichteinmischung und Nichtteilnahme am politischen und wirtschaftlichen Weltgeschehen galt noch bis zum US-Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Und auch die europäischen Märkte setzten in dieser Phase eher auf Abschottung. Trotz der politischen Wirren oder wegen der Mangeljahre des Krieges, die es aufzuholen galt, entwickelte sich die Wirtschaft gut. Die Nichtvernetzung der Märkte und die Ablehnung freier Handelsbeziehungen quer über Europa gelten heute als verstärkender Faktor für die Weltwirtschaftskrise in Folge des Schwarzen Freitags am 25. Oktober 1929.
Nach dem Krieg setzten vor allem die USA verstärkt auf Außenhandel. Mithilfe von Naturalleistungen im Zuge der Marshall-Hilfe konnten die erforderlichen logistischen Systeme für einen modernen Welthandel entwickelt werden. Es entstanden Freihandelszonen wie EFTA oder ASEAN und in Europa setzte mit der Montanunion die wirtschaftliche und politische Integration als Vorläufer der EU ein.
Der Welthandel wurde im Rahmen eines völkerrechtlichen Handels- und Zollabkommens – dem sogenannten GATT-Abkommen – geregelt. Bis 1994 wurden in acht Verhandlungsrunden Zölle und andere Handelshemmnisse Schritt für Schritt abgebaut. Die achte GATT-Runde wurde in Uruguay verhandelt. Das Ergebnis war das Entstehen der Welthandelsorganisation (WTO 1995) und ging als Uruguay-Abkommen in die Geschichte ein. Damals gehörten dem Abkommen 123 gleichberechtigte Mitgliedsländer der WTO an. Als Folge des Abkommens nahm die Globalisierung ihren Lauf und der enorme wirtschaftliche Aufschwung vieler Entwicklungs- zu Schwellenländern setzte ein. Deren besondere Bedürfnisse – etwa der Schutz sich entwickelnder Industriezweige oder des Agrarbereichs – hatten im Uruguay-Abkommen noch keine besondere Priorität, weshalb man sich 2001 zu einem Folgeabkommen entschloss, das in der sogenannten WTO-Doha-Runde in vier Jahren verhandelt werden sollte.
Das Doha-Abkommen kam jedoch bis heute nicht zustande. Als Ziel war angegeben worden, die Probleme der Entwicklungsländer mit den Agrarexporten der übermächtigen Industrieländer zu berücksichtigen. Auch verschiedene Fragen des geistigen Eigentums sollten neu verhandelt werden. Die Industrieländer, insbesondere die USA, forderten eine eng begrenzte Patentschutzöffnung, während einige Entwicklungsländer vor allem Medikamente auch ohne Beachtung des Patentschutzes herstellen und vertreiben wollten.
Die Blockade der WTO-Doha-Runde wird durch bilaterale Abkommen gelockert
Selbst wenn die allgemeine friedenschaffende Kraft des Freihandels im Sinne von Immanuel Kant in Zweifel gezogen wird, weil sich vor allem nicht demokratische Regime anderen Zielen als dem Gemeinwohl ihrer Bevölkerung verpflichtet sehen, haben eineinhalb Jahrhunderte gelebten Freihandels gezeigt, dass die Prinzipien von Adam Smith und David Ricardo für Staaten mit ähnlichem Entwicklungsstand und einem einigermaßen homogenen politischen System gelten. Darüber hinaus hat der EU-Binnenmarkt anhand der spektakulären wirtschaftlichen Entwicklung der osteuropäischen Transformationsstaaten gezeigt, dass auch wirtschaftlich unterentwickelte Teilnehmer von einem Abkommen profitieren, solange die wohlhabenden Marktteilnehmer, wie innerhalb der EU vorgesehen, einen Teil ihrer Tauschgewinne für entsprechende supranationale Strukturprogramme in den Transformationsländern einsetzen.
Dass ein Freihandelsabkommen einen klar wirtschaftlich schwächeren Teilnehmer auch ohne supranationales Strukturprogramm beflügeln kann, wurde durch das nordamerikanischen NAFTA-Abkommen, das 1994 zwischen den USA, Kanada und Mexiko abgeschlossen wurde, bewiesen. So konnte Mexiko – bei allen Problemen, die NAFTA im Agrarbereich durch billige Lebensmittel aus den USA und Kanada ausgelöst hat – seine wirtschaftliche Dynamik an das Niveau der USA angleichen. Vor dem Abkommen war Mexikos Wirtschaft wesentlich langsamer als die US-Wirtschaft gewachsen.
Die Geschichte der Globalisierung hat aber auch dargelegt, dass Länder umso stärker vom Freihandel profitieren, wenn sich auch deren öffentliche Hand – im Sinne des »Homo Oeconomicus« – als rationaler Marktteilnehmer verhält. Gerade in ärmeren Staaten bildet der Staat den mit Abstand wichtigsten Nachfrager. Daher gilt die umfassende Korruptionseindämmung als wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Liberalisierung den Wohlstand sämtlicher Markteilnehmer maximiert.
Die EU und die USA wollen mit TTIP ein neues Kapitel des Freihandels aufschlagen
Die Europäische Union ist, gefolgt von den USA, der mit Abstand mächtigste Wirtschaftsraum der Welt. Beide Partner sind wirtschaftlich hoch entwickelte Demokratien. Dennoch unterscheiden sie sich fundamental in ihren Rechtssystemen und hinsichtlich ihrer Standards. Während sowohl die USA als auch die EU-Staaten im Binnenhandel zahlreiche Handelshemmnisse ausgeräumt haben, trifft das nicht auf die wirtschaftlichen Beziehungen zu Drittstaaten zu. Damit ein Freihandels- und Dienstleistungsabkommen zwischen diesen beiden Partnern Sinn ergibt, müssen daher die Zölle und die nicht tarifären Handelshemmnisse beseitigt werden. Außerdem müssen die Standards angeglichen werden.
Von Beginn der Verhandlungen an war beiden Partnern klar, dass ein Abkommen zwischen den beiden stärksten Wirtschaftsräumen der Welt eine enorme multilaterale Wirkung entfalten wird. Die Standards, auf welche sich die EU und die USA einigen, haben große Chancen, von den meisten Drittstaaten übernommen zu werden.
Die Verhandlungsposition der EU wird jedoch dadurch erschwert, dass Europas Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren stark gesunken ist. Gelingt TTIP nicht, schwächt das Europas Wettbewerbsfähigkeit weiter. Das Inkrafttreten des bereits fertig verhandelten, aber noch nicht ratifizierten transpazifischen Freihandelsabkommen TPP würde dazu führen, dass Europa ohne TTIP zusätzlich an Dynamik verliert und tendenziell ins Abseits zu geraten droht. Die EU hat in den letzten Jahren übrigens 27 Freihandelsverträge nach ähnlichem Muster wie TTIP abgeschlossen und verhandelt aktuell mit Japan, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.
TTIP sollte ähnlich wie die 27 bestehenden EU-Freihandelsabkommen auf Experten- und Diplomatenebene abschlussreif verhandelt werden, bevor der fertige Pakt den Vertragspartnern zur parlamentarischen Ratifizierung vorgelegt wird. Zumindest erschien es zu Verhandlungsbeginn plausibel, die gesetzgebenden Körperschaften nicht mit Standpunkten zu konfrontieren, die sich am Ende als doch nicht haltbar erweisen, weil sie etwa im Abtausch mit Zugeständnissen der Gegenseite in anderen Bereichen aufgegeben werden müssen. Da zahlreiche Verbände und deren Lobbys auf die Verhandlungen Einfluss zu nehmen versuchen, ist die Geheimhaltung sinnvoll. Um diese zu durchbrechen, hat »Wikileaks« sogar monetäre Belohnungen für Details über die TTIP-Verhandlungen in Aussicht gestellt. Und weil es vor allem in Deutschland tatsächlich zur Veröffentlichung von halbausgehandelten Details kam – was dem Verhandlungsverlauf natürlich schadete und die europäische Position schwächte –, wollte die zuständige EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström den Zugang zu den TTIP-Verhandlungsdokumenten weiter einschränken. Mit TTIP soll, wie bei allen Freihandelsabkommen zuvor, ein gemeinsamer rechtlicher Rahmen für wirtschaftliche Auseinandersetzungen festgelegt werden. Vereinbarungen zum bilateralen Investitionsschutz, sogenannte BITs (Bilateral Investment Treaty), gehören zum internationalen Standard. Aktuell sind weltweit knapp 3.400 BITs in Kraft, davon betreffen 1.400 die EU-Mitgliedsstaaten. Allein Österreich hat 621 Investitionsschutzabkommen abgeschlossen, um die Interessen seiner Wirtschaft auf internationalen Märkten zu schützen.
Bei TTIP ohne Investitionsschutz würde ansonsten das Recht des Stärkeren gelten. Bisher konnte es sich nämlich kaum ein kleineres europäisches Unternehmen leisten, vor einem US-Gericht einen Prozess zu führen. Dass sich die Globalisierungsgegner ausgerechnet diesen Punkt herausgepickt haben, um gegen TTIP Stimmung zu machen, ist daher nicht nachvollziehbar. So verhindert der Investitionsschutz nicht nur Urheberrechtsverletzungen, sondern auch, dass etwa EU-Firmen bei US-Geschäften ein unkalkulierbares Risiko eingehen, weil einige US-Bundesstaaten extrem niedrige Klageschwellen als Blockadeinstrumente gegen europäische Wettbewerber einsetzen. Die EU-Kommission hat vor wenigen Wochen einen neuen Vorschlag für ein Streitbeilegungssystem im Rahmen von TTIP präsentiert. So soll anstatt der grundlos umstrittenen Schiedsgerichte ein öffentliches Investitionsgericht in zwei Instanzen über Auseinandersetzungen im Rahmen des Abkommens entscheiden. Die Verfahren sollen ähnlich wie beim WTO-Berufungsgericht ablaufen.
Was bringt TTIP den Österreichern
Einwände gegen TTIP kommen vor allem aus dem Lebensmittelhandel und aus der Landwirtschaft. Die Lebensmittelgiganten »Spar« und »Rewe« nützen ihren medialen Einfluss als zwei der größten Werber des Landes, um gegen das Abkommen zu argumentieren. TTIP-Befürworter werfen dem Lebensmittelhandel jedoch gezielte Panikmache vor. Spar und Rewe seien nur deswegen gegen das Abkommen, weil sie neue Mitbewerber auf dem österreichischen Markt zu verhindern suchen.
Für den steirischen Wein, ein Spitzenprodukt der steirischen Landwirtschaft, sieht Weinbaudirektor Werner Luttenberger die Chancen und Risken des Abkommens ausgewogen. Für die Marktchancen in den USA sei ein Abkommen positiv. Klar sei aber auch, dass die USA einen Standard wollen, der alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist, während die Österreicher die Meinung vertreten, dass beim Wein alles verboten sein solle, was nicht explizit erlaubt ist. Besonders problematisch sieht Luttenberger den Einsatz der in den USA üblichen Schleuderkegelkolonne (Spinning Cone Column) zur Aromenextraktion. Damit lassen sich Geschmackskomponenten unabhängig von Weinsorte und Terroir verstärken oder abschwächen. Das Verfahren ist in Österreich streng verboten, in Deutschland jedoch zur Reduzierung des Alkoholgehaltes erlaubt.
Große Hoffnungen in TTIP setzen der österreichische Außenhandel und die Industrie. Im Jahr 2014 haben die österreichischen Exporte in die USA um zehn Prozent auf 7,8 Milliarden Euro zugenommen. Damit sind die USA bereits der drittwichtigste österreichische Exportpartner. Derzeit wird etwa jeder zehnte österreichische Arbeitsplatz durch österreichische Exporte in die USA gesichert. Die österreichischen Direktinvestitionen in den USA lagen im Vorjahr bei 7,4 Milliarden Euro. Und mit 14 Milliarden Euro bis zum Jahr 2014 sind die USA der viertgrößte Investor in Österreich.
TTIP würde die wirtschaftlichen Beziehungen durch den Wegfall von Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen weiter kräftig ankurbeln. So ist ein jährlicher BIP-Anstieg von 1,75 Prozent über acht Jahre hinweg zu erwarten.
EU-weit werden 15 Prozent der Arbeitsplätze durch Exporte in die USA gesichert. Die EU-Kommission geht nach einem Inkrafttreten des Abkommens von einem jährlichen Zuwachs der EU-Wirtschaftsleistung von 119 Mrd. Euro und einem BIP-Wachstum von 0,5 Prozent über zwölf Jahre hinweg aus. Während die österreichische Wirtschaft heuer nur um 0,8 Prozent wachsen wird, rechnen die USA mit 3,1 Prozent Wirtschaftswachstum. Österreich würde durch TTIP also auch von der wirtschaftlichen Dynamik der USA profitieren. Die positiven Folgen wären in der Steiermark als Bundesland, in dem jeder zweite Arbeitsplatz indirekt am Export hängt, besonders ausgeprägt. Am stärksten profitiert die Industrie. Daher gehört Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann zu den wenigen Politikern, die sich dem Mainstream entgegenstemmen und ein Abkommen ausdrücklich begrüßen. Europäisches Recht dürfe jedoch nicht unterlaufen werden, so Buchmann. Für die Anti-TTIP-Stimmung in machen EU-Ländern macht er vor allem die schlechte Kommunikation durch die EU-Kommission verantwortlich. -jot-
Titelgeschichte Fazit 118 (Dezember 2015) – Illustration: Peter Pichler
Kommentare
Antworten