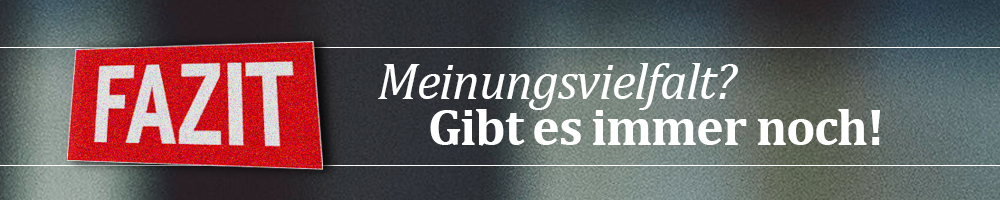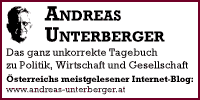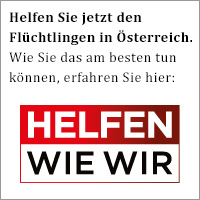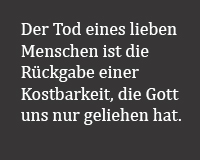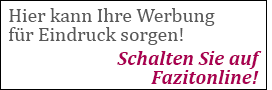Tandl macht Schluss (Fazit 216)
Johannes Tandl | 15. Oktober 2025 | Keine Kommentare
Kategorie: Fazit 216, Schlusspunkt
Draghis Mahnmal der verpassten Chancen. Vor einem Jahr hat Mario Draghi, Wirtschaftswissenschafter und ehemaliger Chef der Europäischen Zentralbank, schonungslos offengelegt, dass Europa wirtschaftlich auf tönernen Füßen steht. Das Wachstumsmodell ist ausgereizt, Abhängigkeiten machen die EU erpressbar, und ohne dynamischere Entwicklung lassen sich weder Klimaziele, Digitalisierung noch Sicherheitspolitik finanzieren.
::: Hier können Sie den Text online im Printlayout lesen: LINK
Ein Jahr später zeigt sich zwar, dass Draghis Diagnose richtig war – die Probleme sind inzwischen aber noch größer geworden, weil die notwendigen Reformen ausblieben. Die Schwäche des europäischen Modells tritt immer offener zutage. Der Exportmotor stottert, die USA schotten sich mit Zöllen ab, China flutet die Märkte mit seinen Industrieprodukten. Und Europas Reaktion ist bestenfalls halbherzig. Ein Mercosur-Abkommen hier, ein Rohstoffprojekt dort, steigende Verteidigungsausgaben überall. Weil die Staaten aber trotz wachsender Rüstungsetats nicht bereit sind, Sozial- und Verwaltungsausgaben zu kürzen, droht schon wieder eine neue Eurokrise. Dabei liegt der nationale Investitionsbedarf der Mitgliedsländer laut Draghi inzwischen bei jährlich 1.200 Milliarden Euro.
Draghi hat drei Prioritäten formuliert: Technologische Innovationslücken schließen, den Green Deal wachstumsfreundlich ausgestalten und Europas ökonomische Sicherheit stärken. Die EU-Kommission greift diese Punkte zwar auf, doch für den Paradigmenwechsel fehlten ihr Kraft und Rückendeckung. Daher hinkt Europa in den entscheidenden Zukunftsfeldern immer weiter hinterher. Besonders deutlich wird das bei der Technologiepolitik. Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie. Während in den USA dutzende KI-Modelle von Konzernen wie OpenAI, Google oder Meta entstehen, bringt Europa kaum etwas Durchschlagskräftiges hervor. In den USA werden viele KI-Entwicklungen außerdem für Start-ups als Open-Source-Software offen verfügbar gemacht. Außerdem haben die US-Unternehmen Zugang zu viel größeren Venturecapitalfonds und zu einem einheitlichen Kapitalmarkt statt zu 27 fragmentierten. In Europa fehlt daher das große Geld, mit dem eine gute Idee nach der Forschungsphase in großem Stil ausgerollt werden könnte. Europäische Gründer sind daher auf US-Kapital, auf US-Rechenzentren und auf US-Cloud-Kapazitäten – also auf eine Verlagerung in die USA – angewiesen. Mit ein paar europäischen Forschungsprogrammen oder Exzellenzzentren ist es nicht getan.
Das Kernproblem sind zersplitterte Märkte. Ein Startup aus Wien muss trotz Binnenmarkt 27 verschiedene Märkte bedienen, statt nur einen einzigen. Diese fehlende Skalierung verhindert die globale Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu kommen überzogene Regulierung und fragmentierte Infrastrukturen. Strom kostet in Europa doppelt so viel wie in den USA. Draghi fordert kollektive Gaseinkäufe, die Entkopplung der Strompreise vom Gas und einen massiven Netzausbau. Die EU setzt stattdessen auf gelockerte Beihilferegeln – kurzfristig hilfreich, langfristig wirkungslos. Auch die vielbeschworene »strategische Souveränität« bleibt ein Schlagwort. Brüssel erkennt zwar, dass Wirtschaft und Sicherheit zusammengehören. Doch statt gemeinsamer Projekte dominieren nationale Initiativen, während China und die USA mit massiven Industrieprogrammen Fakten schaffen. In der Sicherheitspolitik dasselbe Bild. 27 Beschaffungen statt einer gemeinsamen. Draghi fordert mehr Geschwindigkeit und mehr gemeinsame Kraft. Stattdessen verteilt die EU ihre Mittel auf dutzende Projekte, während andere Länder Milliarden in einzelne Champions investieren. Europas Industriepolitik bleibt kleinteilig, weil die Mitgliedsstaaten ihre Souveränität verteidigen und Brüssel föderale Instrumente scheut.
Europa müsste endlich Tabus brechen. Dazu gehören gemeinsame Energie- und Kommunikationsnetze, eine einheitliche Bahninfrastruktur und echte Industrieprogramme. Doch die Politik verharrt im Ritual des kleinsten gemeinsamen Nenners. Im EU-Rat fehlt die Kraft zum Kurswechsel. Der Draghi-Report hat klar gezeigt, dass die EU ihre Grundlagen völlig neu ordnen muss. Doch solange sie nur Symptome beklagt, statt ihre Fundamente zu erneuern, bleibt Draghis Analyse ein Mahnmal der verpassten Chancen.
Tandl macht Schluss! Fazit 216 (Oktober 2025)
Kommentare
Antworten